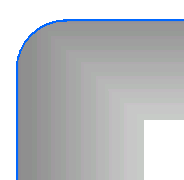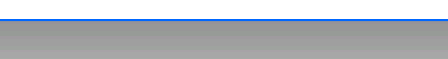Er befand sich, etwa 3000 km von Deutschland entfernt, in den südlichen Ausläufern des Uralgebirges, im Norden der kasachischen Steppe. Hierher wurden im April/Mai des Jahres 1945 etwa 2400 Deutsche aus Danzig und Ostpreußen zur Zwangsarbeit deportiert, Frauen und Mädchen, Jungen und Männer. Zu ihnen gehörte auch ich, damals knapp 16 Jahre alt. Wir waren von Greifkommandos des NKWD willkürlich gefangengenommen worden, nachdem die Rote Armee im Februar und März 1945 Ost- und Westpreußen erobert hatte. Neben allen Gemeinsamkeiten hatte jeder von uns auch seine eigenen Erlebnisse, seine eigene Sicht auf das Geschehen. Manches konnten wir erst nach Jahrzehnten begreifen, vieles können wir bis heute nicht verstehen. Wie war das damals – als die Russen zu uns kamen, als wir gefangengenommen wurden und uns auf dem Leidensmarsch von Danzig bis nach Graudenz schleppen mussten, als wir, zusammengepfercht in Viehwaggons, bis nach Kasachstan transportiert wurden? Was mussten wir alles im Lager erleben, und wie sind wir schließlich heimgekehrt? Manfred Peters, „Sechzehnjährig im Gulag“ (Auszug) Danzig am 29. März 1945: Es sollte der Tag Null in meiner Biographie werden. Ein schrecklicher Tag und eine noch schrecklichere Nacht lagen hinter uns. Mein Vater und ich fassten den Entschluss, den Keller zu verlassen und in unsere Wohnung im vierten Stock zu gehen, um zu sehen, was davon noch übriggeblieben war. Jedoch kamen wir nur bis in den unteren Hausflur, der durch einen Lichtschacht knapp beleuchtet war. Aus dem Halbdunkel schallte uns ein unmissverständliches „Stoi!“ entgegen. Wir erblickten einen Offizier mit einer Gruppe Uniformierter. Noch ahnten wir nichts von unserem Unheil. Neben dem Offizier stand unser Nachbar Franz Schulz - er musste dolmetschen. Doch es gab nicht viel zu dolmetschen. Der Offizier fragte uns nur nach unserem Alter, ohne dass ich an seinem Gesichtsausdruck etwas ablesen konnte. Ich war gerade erst sechzehn, mein Vater achtunddreißig Jahre alt. Da sagte der Offizier ein Wort, das ich hier zum ersten Mal hörte, das mir aber die nächsten Jahre ständig in den Ohren klingen sollte: „Dawai!“ Die Situation war so unmissverständlich, dass dieses Wort der Übersetzung nicht bedurfte. Wir beruhigten meine Mutter, die inzwischen hinzugekommen war. Es konnte sich nach unserem Dafürhalten um nichts anderes handeln, als dass wir für ein paar Stunden irgendwo arbeiten mussten, vielleicht Trümmer forträumen, so dass wir bis zum Abend sicher wieder zu Hause wären. Die Gruppe Bewaffneter graste einige weitere Häuser der Wallgasse und der nahegelegenen Bäckergasse ab, bis sie es auf etwa zwanzig deutsche Männer gebracht hatte. Dann wurden wir unter Bewachung bis zum entgegengesetzten Teil unserer Stadt geführt. Schließlich befanden wir uns in unmittelbarer Nähe eines großen, weitgehend unversehrt gebliebenen Gebäudekomplexes, den wir bisher nur von außen kannten, in den wir nun jedoch hineingeführt wurden. Wir waren in nichts anderem angekommen als im Danziger Zuchthaus, bekannt unter dem Namen Schießstange. Meinem Vater und mir wurde klar: Mit einem kurzfristigen Arbeitseinsatz hatte das alles hier nichts zu tun. Aber was sollte es dann bedeuten? Wir hatten nichts verbrochen, waren nicht einmal Nazis, im Gegenteil. Mein Vater war Mitglied der KPD bis zu ihrem Verbot 1933 gewesen und hatte im KZ Stutthof gesessen. Ich war zwar Mitglied der HJ, aber das waren nach dem Gesetz fast alle Jugendlichen auch. Gerade erst, im Januar dieses Jahres, war ich von HJlern zusammengeschlagen worden, weil ich ihre Fahne nicht mehr gegrüßt hatte. Das alles hier konnte nur ein Irrtum sein und musste sich umgehend aufklären. Mein Vater und ich kamen zunächst gemeinsam in eine größere Zelle, die wir mit etlichen anderen teilten. Keiner wusste, warum er hierher geraten war. Doch viel wurde unter diesen Bedingungen auch nicht mehr gesprochen. Mit dem, was uns widerfahren war, hatte wohl kaum jemand gerechnet, so dass es uns allen die Sprache verschlug . Für meinen Vater, einen Kommunisten, muss diese Erfahrung unvorstellbar bedrückend gewesen sein, widersprach sie doch völlig allem, woran er all die Jahre der Naziherrschaft unerschütterlich geglaubt hatte, so dass er sicher nicht wusste, was er zu mir, seinem Sohn, nun sagen sollte. Jedenfalls schwieg er. Ohnehin konnte er für mich hier nicht mehr tun, als dass er mich in Schutz nahm, wenn die anderen Zelleninsassen auf mich als Jüngsten die in der Zelle zu leistende Drecksarbeit abwälzen wollten. Am nächsten Vormittag wurden wir zum Verhör geholt, jeder einzeln. Nun musste sich eigentlich alles aufklären. Ich wurde nur nach meinem Namen und nach meinem Alter gefragt - Ausweise hatte ich nicht bei mir - und danach, ob ich in der Streifen-HJ, einer HJ-Formation mit polizeilicher Funktion, gewesen wäre, was natürlich auf mich nicht zutraf. Eigentlich hätte ich hier schon erkennen müssen, dass es für unsere Gefangennahme der Gründe nicht bedurfte. Mein Verhör war sehr kurz. Ich wurde bald hinausgeführt und dachte in meiner jugendlichen Naivität, dass ich nun nach Hause gehen dürfte. Doch es öffnete sich eine andere Zellentür für mich. Ich stellte fest, dass es sich um eine Einzelzelle handelte. Für diesen Raum hatte ich schon gar keine Erklärung mehr. Das erste Mal in meinem Leben dachte ich: ‘Das war’s also, hier kommst du lebend nicht mehr raus.’— Es dauerte jedoch nicht lange, und die Zellentür öffnete sich für den nächsten, der eben so wenig wie ich wusste, aus welchem Grunde er hier hereingekommen war. Schließlich waren wir in dieser Einzelzelle zwölf (!) Mann, einer so ratlos wie der andere. Ich war auch hier von allen der Jüngste. Das gab mir zumindest die Hoffnung, dass die Russen mit mir nichts Besonderes vorhätten und ich früher oder später hier auch wieder lebend hinauskommen würde. Von meinem Vater fehlte jede Spur. Tage später wurde ich über einen Gang geführt, und ich sah ihn unten auf dem Gefängnishof in einer Gefangenenkolonne stehen. Ich ahnte nicht, dass ich meinen Vater hier zum letzten Mal gesehen hatte. So brachte ich mehr als eine Woche zu, ohne dass irgend etwas mit mir geschah. Der Umstand, dass für uns zwölf Mann nur ein Klosettbecken in einer Ecke der Zelle offen stand, wurde dadurch erleichtert, dass wir kaum etwas zu essen bekamen. Einzelne von uns wurden schließlich aus der Zelle geholt und kamen nicht wieder, ohne dass wir etwas über sie erfuhren. Sie konnten, davon waren wir überzeugt, nur nach Hause geschickt worden sein, und als nächster würde man dieses Glück auch haben. Endlich wurde auch ich aufgerufen und durfte diese Zelle verlassen. Ich wurde auf eine Straße außerhalb des Zuchthauses gebracht. Da jedoch stand bereits eine lange Kolonne von deutschen Männern, sechs in einer Reihe, und ich musste mich an ihr Ende stellen. Doch war ich bald nicht mehr der letzte. Das sah nicht so aus, als würden sich meine Hoffnungen erfüllen. Im Gegenteil, nach stundenlangem Warten, begleitet vom Dawai-Dawai-Schreien etlicher mit Maschinenpistolen oder Schnellfeuergewehren mit Zielfernrohr für Scharfschützen Bewaffneter, setzte sich diese Kolonne schließlich in Marsch. Das Ziel war uns unbekannt. Nach meinem heutigen Wissen waren mein Vater und ich von einem der zahlreichen Greifkommandos des NKWD gefangen genommen worden, denen auf Befehl Stalins allein in Danzig mehr als zehntausend Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sowie Flüchtlinge aus Ostpreußen, die hier von der Front überrollt worden waren, zum Opfer fielen. Ankunft im Lager: In etwa ein Kilometer Entfernung, abseits der Siedlung, erblickten wir ein stacheldrahtumzäuntes, mit Wachtürmen umgebenes Barackenlager, flach in die Steppe geduckt. Dorthin schleppte sich unser langer Zug, Frauen und Männer, Mädchen und Jungen. Das Lagertor war wie der Rachen eines Molochs, der uns allmählich verschlang. Unsere Lage schien mir ausweglos: ‘In dieser Steppeneinsamkeit sind wir von aller Welt verlassen; was hier mit uns geschieht, bleibt aller Welt verborgen!’ – Ich war verzweifelt... Wir mussten erfahren, dass es für unsere Vielzahl Gefangener viel zu klein war. Ich kam mit etlichen anderen zunächst in einen Bau, der eigentlich als Bade-, Wasch- und Entlausungsstelle, Banja genannt, zu dienen hatte. Wir waren froh darüber, denn in den Waschkesseln befand sich Wasser, wenn auch abgestandenes, mit dem einige von uns, unter ihnen auch ich, ihren Durst stillten. Das war jedoch das Unvernünftigste, was wir tun konnten, und hatte für viele die schlimmsten Folgen. Doch wo sollte in dieser Lebenslage Vernunft herkommen? — Noch am gleichen Tag kam auch ich in eine der Baracken, die zur Gefangenenunterkunft bestimmt waren. Ihre außen wie innen weißgetünchten dicken Wände bestanden aus Lehm. Mir fiel auf, dass sie innen mit unzähligen roten Flecken übersät waren, die ich mir, da sie offensichtlich nicht zur Dekoration dienten, zunächst nicht erklären konnte. Alles um uns herum ließ erkennen, dass vor uns bereits andere hier gehaust haben mussten. Die Baracke war zunächst total überbelegt. Wir standen dicht bei dicht ratlos im Gang, bis wir uns nach und nach für unseren Pritschenplatz entschieden, wir Jungen zumeist in Abhängigkeit von unserem Lebensalter. Jeder musste sich in dieser äußerst schweren Lebenssituation zurechtfinden. Schon am ersten Tag im Lager hatte ich ein mich besonders erschütterndes Erlebnis. Ein Posten des Wachkommandos stand plötzlich in unserer Baracke und fragte, an alle gewandt: „Wer Brot holen?“ Wie viele andere riss auch ich erwartungsvoll meine Hand nach oben und rief: „Ich, ich!“ Ich traute meinen Augen und Ohren kaum, als der Posten auf mich wies und befahl: „Dawai!“ Außer mir hatte ein Zweiter dieses unerwartete Glück. Doch was uns bevorstand, war zwar unerwartet, aber von Glück konnte keine Rede mehr sein. Wir mussten zunächst in den vom Lagertor aus vorderen Teil des Lagers gehen, wo unsere Frauen und Mädchen untergekommen waren. Dort führte uns der Posten durch eine ebenso überbelegte Baracke, zeigte im Halbdunkel auf einen Pritschenplatz und sagte unmissverständlich: „Dawai!“ Doch was nahmen wir wahr? Dort lag eine Tote!— Wir schleppten sie durch die Baracke, begleitet von den trostlosen Blicken der Frauen dort, und luden sie auf einen davor bereitstehenden Karren. Diesen hatten wir mit unserer traurigen Last aus dem Lager hinaus in die Steppe zu transportieren, gefolgt von dem mit Karabiner und aufgepflanztem Bajonett bewaffneten Posten. Schließlich kamen wir zu einer Grube, die vor uns andere bereits ausgeschachtet hatten. Dort hinein legten wir diese Frau, für die alles nun ein Ende hatte.— Wir nahmen den mitgeführten Spaten und warfen dieses Grab mit der ringsum aufgeschütteten Erde zu. Der Posten führte uns in das Lager zurück und, zu unserer Verwunderung, in dieselbe Frauenbaracke. Dort erfüllte er auf seine Weise das uns zu Beginn gegebene Versprechen: Am Fußende des Pritschenplatzes, auf einem dort befestigten Ablagebrett, lag die letzte Brotration der Toten. Die durften wir zwei uns teilen!— Danach wurden wir von dem Posten in unsere Baracke zurückgeführt. Die Nacht verbrachte ich auf meinem Pritschenplatz, wie eine Sardine in einer Konservenbüchse dicht bei dicht zwischen meine beiden Pritschennachbarn eingezwängt, so dass wir uns zwar gegenseitig wärmten, aber uns nicht zu bewegen wagten. Kaum jedoch war die einzige von der Decke herabhängende Glühbirne erloschen, spürte ich ein Kribbeln und starken Juckreiz erzeugendes Stechen auf meinem Körper. Ich musste mich bewegen, ob ich wollte oder nicht, und es gelang mir, einige der Urheber zu zerquetschen. Das hatte einen üblen, beißenden Geruch zur Folge. Dennoch schlief ich vor Erschöpfung schließlich ein. Wie sich am Morgen herausstellte, war es allen anderen genau so ergangen. Ich musste mir erklären lassen, dass es Wanzen waren, die uns in der Dunkelheit gepeinigt hatten, und war in dieser Nacht um eine weitere Erfahrung „reicher“ geworden. Denn bis dahin hatte ich von diesen Tierchen zwar gehört, aber sie nie selbst erlebt. Das hatte sich von nun an gründlich geändert. Aufdiese Weise konnte ich mir auch die unzähligen roten Flecken auf der weißgetünchten Wand erklären. Sie zeugten von dem zwar erfolgreichen, aber dennoch aussichtslosen Kampf unserer Vorgänger gegen diese Plagegeister.“ S.18f. (Das Lager 1902 in Kimpersai): Das Lager war im Rechteck von einem Stacheldrahtzaun umgeben. An den vier Ecken befanden sich Wachtürme, jeweils besetzt von einem maschinenpistolenbewaffneten Posten. Ein weiterer Posten stand am Lagertor, in der Mitte des Zaunes an der einen, Kimpersai zugewandten, langen Seite. Das Tor wurde von einem Sowjetstern „geziert“. Der Flachbau daneben diente den Offizieren der Lagerleitung und den Soldaten der Lagerwache. Dahinter standen auf der linken Lagerseite, nebeneinander gereiht, die Baracken der Gefangenen, zunächst die der Frauen, dahinter die der Männer, beides von einem weiteren Stacheldrahtzaun mit einem kleinen Tor getrennt. Rechts vom Frauenlager befand sich der Karzer, der sich bedrohlich in die Steppenerde kauerte und, nur ganz flach lauernd, darüber hinausragte. Der Hauptweg des Lagers führte vom Lagertor bis ins Männerlager, wo sich rechts des Weges das flache Gebäude mit Küche und Speiseraum, dahinter ein Bau für Verpflegung mit einem Keller für Leichen und links daneben die Krankenbaracke mit Lagerambulanz befanden. Hinter den Männerbaracken, auf der linken Lagerseite, war der Ort, auf dem wir Männer unsere Notdurft verrichten mussten, in der Seuchenzeit ständig überfüllt und umlagert. Weiter links davon befand sich die Banja. Die meisten von uns kamen aus der Stadt Danzig und den sie umgebenden Orten, wie Langfuhr, Oliva, Zoppot, Ohra, Schidlitz, Praust, und aus umliegenden Dörfern. Viele jedoch waren aus Ostpreußen vor der Sowjetarmee gen Westen geflohen, mit ihrem Treck über das eisbedeckte Frische Haff, in Danzig von der Front überrollt und dann deportiert worden. Frauen waren darunter, denen ihre Kinder von dem Greifkommando des NKWD aus den Händen gerissen und die zum Mitkommen aufgefordert wurden, ohne, wie bekanntlich auch ich, zu wissen, was mit ihnen geschehen sollte Erste Wochen im Lager: Vor uns lag zunächst eine dreiwöchige Quarantänezeit, während der wir in der Regel das Lager nicht verließen, sondern es, so gut das möglich war, in Ordnung zu bringen hatten. Allmählich entstanden vor den Eingängen kleine Gärten mit schmuckvoll gefertigten Bildern aus Steinen, die in verschiedener Färbung und Größe im Lager zu finden waren. Auch wurden wir in Bewegung gehalten, indem wir in langer Kette kleinere Steine mit bloßen Händen von der einen Stelle des Lagers zur anderen zu tragen hatten, was mir damals sinnlos erschien, aber als Bewegungstherapie wohl doch seinen Sinn hatte. Dabei quälte uns die in dieser Steppe um diese Jahreszeit bereits herrschende Sonnenglut. Bei Reparaturen an Wasserleitungsrohren ahnten wir schon ein wenig, was uns dagegen im Winter erwarten würde. Die Rohre waren in zwei Meter Tiefe verlegt, wo wir Ende Mai immer noch auf Eis stießen!— Zum Schlafen legten wir uns vor die Baracken – dort ließen uns wenigstens die Wanzen einigermaßen in Ruhe. Zu essen gab es morgens, mittags und abends einen halben Liter wässriger Suppe mit einem kleinen Stück Brot, zu Mittag meist ein wenig Grütze- oder Hirsebrei, Kascha genannt. Unser starkes, quälendes Hungergefühl war damit nicht zu stillen. Wir mussten diese Mahlzeiten im größten Gebäude unseres Lagers an einem Essenschalter in Empfang nehmen. Über dem Schalter prangte wie zum Hohn eine Stalinsche Grundweisheit: „Wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen.“ Das hatte Marx doch wohl etwas anders gemeint, oder?— Noch war der große Raum davor mit Gefangenen belegt, voll wie die Baracken auch. Einige Zeit war ich ebenfalls dort untergebracht. An der dem Lagertor zugewandten Giebelseite prangte ein Stalinzitat, das mir bereits am ersten Tag aufgefallen war: „Die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt.“ (Diese Losung hat ihren Wahrheitsgehalt nach fast fünf Jahrzehnten endlich bestätigt, wenn auch ganz anders, als der Josef Wissarionowitsch sich das damals gedacht haben mag!) Die hygienischen Bedingungen blieben katastrophal! Da war es im Männerlager schon eine Errungenschaft, wenn in der Mitte eine Grube ausgehoben wurde und wir an der einen Seite einen „Donnerbalken“ befestigten, so daß wir unser „Geschäft“ zwar im Freien, aber wenigstens nach deutscher Manier sitzend verrichten konnten. Später wurde eine überdachte Einrichtung gebaut, wo die „russische Methode“ wieder praktiziert werden musste. Es dauerte nicht lange, bis das geschah, was in krassem Gegensatz zur Quarantäne stand, was jedoch unter diesen Bedingungen der physischen Belastung, der Verpflegung, der hygienischen Bedingungen, der medizinischen „Versorgung“, der klimatischen Gegebenheiten und vor allem des psychischen Zustandes der Frauen und Männer (wir Jungen wurden besser damit fertig) geschehen musste: In zunehmendem Maße wurden Seuchen zur Geißel unseres Lagers! Überhaupt waren wir alle so geschwächt, dass eine Krankheit, hatte sie den Organismus einmal gepackt, kaum mehr umzukehren war. Ärzte, die unter uns Gefangenen waren, so Dr. Dowig und Dr. Dübbers, taten gemeinsam mit den Männern und Frauen, die sich für die risikovolle Arbeit in der Krankenbaracke voller Seuchenkranker aufopferungsvoll zur Verfügung gestellt hatten, das unter diesen Bedingungen Mögliche. Später waren es auch der aus einem Stalingrad-Kriegsgefangenenlager zu uns abkommandierte Militärarzt Dr. Hein sowie eine sowjetische Ärztin, die den schweren Kampf vor allem gegen die grassierenden Seuchen Ruhr, Typhus und Gesichtsrose aufnahmen - viel zu oft vergebens. Medikamente und Verbandsmaterial gab es so gut wie gar nicht. Die sommerlichen Temperaturen, bis zu 50 Grad Hitze, und die mangelhafte Hygiene, zahllose Wanzen und schließlich auch Läuse taten ihr Übriges. Daran konnte auch das wöchentliche Duschbad in der Banja mit Entlausung der Kleidung nichts ändern. Trotz der Seuchenerkrankungen war die Zeit der Quarantäne nach den verordneten drei Wochen beendet, und die Zeit der Sklavenarbeit begann. Im August 1945 hatten die Todesfälle ihren Höchststand erreicht. Täglich gingen dann über einen längeren Zeitraum in unserem Lager zwanzig, dreißig und mehr Menschen elend zugrunde. Jeder von uns musste fürchten, zu den nächsten zu gehören. Viele von denen, die in die Krankenbaracke eingeliefert wurden, mussten nach wenigen Tagen tot hinausgetragen werden. Wenn Sie das ganze Buch kennenlernen möchten, klicken Sie hier  |